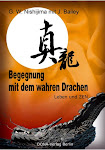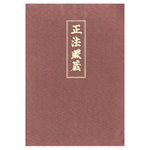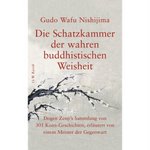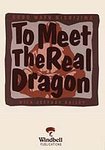Die
materielle Welt wird von uns durch die Sinnesorgane wahrgenommen. Im Zuge der
Naturwissenschaft und Technik sind unsere Methoden und Hilfsinstrumente für diese
Wahrnehmung ganz erheblich verbessert worden, sodass wir in der Lage sind weit
in das Weltall hineinzuschauen und
auch sehr konkret zu messen und zu beobachten, was im atomaren und sogar im subatomaren
Bereich vorhanden ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es sich letztlich dabei
immer um Repräsentationen dieser materiellen Welt in unserem Gehirn handelt. Es finden also zwischen der
materieller Wirklichkeit und unserem Bewusstsein diverse Umwandlungsprozesse
der Daten stattf, die naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten belastet sind.
Der
Buddhismus geht von der Existenz einer realen Welt aus, die immer eine Verschmelzung von Geist und Materie ist.
Extreme Positionen wie der Idealismus und der Materialismus können die
Wirklichkeit in ihrem vollen Umfang nicht
erfassen. Sie sind gleichwohl wichtige Teilsichten der Wirklichkeit.
Vers
1
Wenn
wir davon ausgehen, dass die externe Welt in der Vergangenheit erschienen ist,
bedeutet dies, dass wir an die Eigenschaften des Erscheinens, der Fortdauer und
des Verschwindens gebunden sind.
Dabei
entsteht die Frage, wie sich die Welt uns jetzt darstellt, im Verhältnis zu dem,
was früher erschienen ist.
Wir
wissen heute aus der Naturwissenschaft, dass unsere Welt vor vielen Milliarden
Jahren entstanden ist, wenn wir den Urknall als Beginn akzeptieren. Zweifellos
leben wir in einer Zeit, in der die materialistische Weltanschauung eine hohe
Bedeutung hat und sicher vorherrschend ist. Dabei stellen wir uns die Zeit als
lineare Verbindung von der Vergangenheit zur Gegenwart und weiter in der
Zukunft vor. Dies ist ein Modell der Zeit, das nicht in der Lage ist, spirituelle und existentielle Wirklichkeiten,
um die es im Buddhismus immer geht, real und wirklichkeitsgetreu zu erfassen.
Im
Buddhismus sind das Erleben und die Erfahrung im gegenwärtigen Augenblick von zentraler Bedeutung: Im Augenblick
gibt es aber kein Entstehen und kein Vergehen, weil alles im Augenblick
zusammengefasst ist. Eine lineare Zeit ist mit dem Augenblick also nicht
vereinbar.
Wir
stellen uns dabei durchaus vor, dass die Wirklichkeit in früheren Zeiten anders
ausgesehen hat.
Vers
2
Die
Charakteristika Erscheinen, Fortdauer und Vergehen sind niemals sehr klar.
Die
externe Welt mit ihren vielfältigen Dingen und Phänomenen mag an einem Ort
sein.
Nach
der sogenannten Unschärferelation von Heisenberg sind in der Naturwissenschaft
die Grenzen der genauen Beobachtung im subatomaren Bereich aufgezeigt. Selbst
bei bester Messung ist es grundsätzlich nicht möglich, den genauen Ort zusammen
mit verschiedenen anderen Parametern präzis zu messen. Dabei ist auch die Zeit
als naturwissenschaftlicher Parameter wichtig.
Das
Universum nehmen wir manchmal als Einheit und manchmal als die Vielheit der
Dinge und Phänomene wahr.
Im
mittleren Größenbereich unserer direkten Wahrnehmung scheinen die Dinge an
einem bestimmten Ort zu sein, aber sie bewegen sich, wenn wir die lineare Zeit
voraussetzen.
Vers
3
Das
Typische und Charakteristische der externen Welt ist verschieden von dem
Erscheinen, Fortdauern und Vergehen.
Damit
ist wieder der gegenwärtige Augenblick angesprochen, in dem die Wirklichkeit
existiert, und der von der linearen Zeit verschieden ist. Damit gibt es auch
nur ein Universum, das gleichzeitig mit uns existiert.
Die
Verbindung verschiedener Zustände bei den Dingen in der Außenwelt wird durch unser Denken hergestellt, ist also in
der Wirklichkeit so nicht vorhanden. Wir sagen z.B. dass die Asche nach dem
Verbrennen aus dem Feuerholz entstanden ist. Dies ist jedoch ein gedanklicher
intellektueller Verbindungsprozess. Bei der genauen Beobachtung im Augenblick
gibt es nur entweder das Feuerholz oder in einem anderen Augenblick die Asche.
Eine gedankliche Schlussfolgerung und Bewertung mag zwar für manche
organisatorischen Aufgaben in unserem Leben sinnvoll sein, aber sie beschreibt
die Wirklichkeit nur sehr teilweise.
Vers
4
In
diesem Vers stellt Nagarjuna fest, dass die verschiedenen Dinge und Phänomene
dieser Welt unabhängig von einem sogenannten
Ursprungs- oder Fundamentalphänomen sind. Das heißt, dass sie sich nicht
auf einen solchen gedachten Ursprung eines einzigen Phänomens zurückführen
lassen.
Wenn
es ein solches Urphänomen gebe, könnte dieses ebenfalls nicht ewig, unabhängig
und unveränderlich sein, sondern würde ebenfalls jeweils neu im Augenblick
erzeugt.
Damit
tritt Nagarjuna einer einfachen Vorstellung entgegen, dass z.B. Gott oder eine
Urkraft außerhalb der Wirklichkeit existiert, unabhängig ist und sich nicht
verändert. Derartige Glaubensinhalte gibt es in vielen Religionen.
Vers
5
Dôgen
vertieft seine Untersuchungen über das Verhältnis der vielfältigen Dinge und
Phänomene zu einem möglichen Urphänomen
und stellt die Frage, ob nicht die Vielen Phänomene das Urphänomen miterzeugen.
Logisch könnten wir dies so verstehen, dass das Urphänomen in den Einzelheiten
enthalten ist und umgekehrt.
Vers
6
Wenn
das Urphänomen außerhalb der Vielfalt dieser Wirklichkeit sein würde, gehörte
es nicht zur Wirklichkeit. Dann könnte es auch nicht die Wirklichkeit erzeugen,
weil es außerhalb stünde.
Wenn
wir eine Dualität von Gott und Wirklichkeit der Welt annehmen, wäre er in der
Tat außerhalb der Wirklichkeit. Ein solcher Glaube wird von Nagarjuna
abgelehnt.
Vers
7
In
diesem Vers wird auf das Problem eingegangen, dass ein angenommenes Urphänomen
die Welt so erschaffen müsste, wie sie ist, das heißt mit allen den negativen
Phänomen und unmoralischen Handlungen.
Ein
solcher Denkansatz ist in zweifacher Weise problematisch: Wenn wir Gott als
Urphänomen verstehen, wäre er nicht allmächtig, weil er auch das Negative und
die Verbrechen in der Welt erschaffen hat. Wenn es aber etwas vollständiges
Gutes als Urphänomen z.B. als Gott gäbe, kann es auch nicht zutreffen, dass er
das Schlechte und Böse erschafft, weil er dann nicht vollständig gut wäre.
Dies
ist zweifellos auch ein ungelöstes Problem der Theorie des Christentums und
anderer Glaubensreligionen, das sich mit dem denkenden Intellekt nicht auflösen
lässt.
Denn
zweifellos gibt es in dieser Welt Gutes und Schlechtes, gibt es selbstloses
Handeln und verbrecherisches selbstsüchtiges Handeln usw..
Vers
8
Das
Leuchten manifestiert sich in der
wirklichen Welt als Verschmelzung des Subjektiven und des Objekt-bezogenen.
In
solchen Fällen manifestieren sich die einzelnen Phänomene als real und sind
ebenfalls eine Verschmelzung des Subjektiven mit dem Objekt-bezogenen.
Leuchten ist ein
Gefühl in uns, wenn wir etwas Leuchtendes sehen. Also ist es eine Einheit von
unserem subjektiven Gefühl und dem objektbezogenen Wahrnehmen. Das Materielle
und Objektive kann gemessen werden und gehört zur materiellen Dimension der
Wirklichkeit. Wir können z.B. die Helligkeit der Sonne oder einer Glühbirne
messen und genau kennen.
Damit
ist jedoch das Wesentliche des Leuchtens
für uns Menschen nicht erfasst. Das materielle Leuchten wäre dann keine
Wirklichkeit im Sinne des Buddhismus.
In
gleicher Weise können wir die Wirklichkeit der Dinge und Phänomen verstehen,
die ebenfalls eine Verschmelzung des Subjektiven und Objekt-bezogenen sind und
sich weder durch das eine noch das andere realitätsnah denken und beschreiben
lassen.
Vers
9
Das
Leuchten und die Dunkelheit interpretiere ich buddhistisch als Verwirklichung,
also Erleuchtung, und Täuschung. Beide erscheinen als gegensätzliche Zustände
und sind miteinander im Konflikt. Aber haben sie eine direkte Beziehung zur
Wirklichkeit? Sind es Entitäten die dauerhaft als Leuchten und Dunkelheit
verstanden werden können?
Erleuchtung
und Täuschung sind zunächst einmal nur Worte
und Vorstellungen. Die reale Wirklichkeit ist davon unabhängig. Der Konflikt besteht also nicht zwischen einer
möglichen Wirklichkeit der Erleuchtung und der Täuschung sondern nur zwischen
den Begriffen und Vorstellungen.
Das
bedeutet, dass sie auf die reale Wirklichkeit überhaupt nicht einwirken können.
Die Dinge und Phänomene dieser Welt existieren unabhängig davon, ob sie
sichtbar sind oder nicht. Ob es also Licht und Helligkeit gibt oder Dunkelheit.
Auch
Dôgen äußert sich in ähnlicher Weise, wenn er sagt, dass wir uns des Zustandes
der Erleuchtung nicht unbedingt bewusst sind.
Vers
10
Es
ist unmöglich, dass die Dunkelheit, also die Täuschung im Sinne des Buddhismus,
durch die Dinge und Phänomene aber auch nicht durch die Dunkelheit selbst
zerstört werden kann. Es gibt z.B. keine Wunderdroge, welche die Täuschung
problemlos beseitigt. Überlegungen und Ideen, die selbst der Täuschung
unterliegen, könnten damit auch die Täuschung nicht überwinden und außer Kraft
setzen.
Was
aber richtig und wahr ist und daher
mit der Wirklichkeit übereinstimmt, hat tatsächlich die Kraft, Falschheit und
Täuschung zu überwinden. Dies kann auf kaum erkennbare Weise vor sich gehen.
Daraus wird die hohe Bedeutung des Gleichgewichts in der Zazen-Praxis und im
täglichen Handeln deutlich. Täuschungen und unmoralische Handlungen können auf
diese Weise ausgeschaltet werden.
Vers
11
Wenn
es für uns unmöglich ist, dass wir etwas sehen können. weil zu wenig Licht da
ist, kann man dies als Folge der Dunkelheit verstehen. Wenn wir in analoger
Weise klar erkennen, dass wir nicht erleuchtet sind, ist dies in gewissem
Umfang Verwirklichung.
Wenn
irgendetwas klar vor uns zu sehen ist, ist es gleichzeitig ein Teil des
Universums. Und in diesem Sinne können wir Dunkelheit als etwas Reales ansehen.
Klar erkannteTäuschung ist in diesem
Sinne also eine gewisse Verwirklichung.
Denn sie ist oft der Anfang intensiver
Praxis, um aus der Täuschung herauszukommen.
Vers
12
Durch
die klare Helligkeit der Erleuchtung können wir die Wirklichkeit der Welt klar
erkennen. die immer eine Einheit von Subjektiven und Objekt-bezogenen ist. In
gleicher Weise ist Dunkelheit eine derartige Einheit von Subjektiven und Objekt-bezogenen
Denken, Sehen und Handeln.
Die
Wirklichkeit ist daher nichts Verborgenes, sondern selbst bei Dunkelheit
vorhanden und erkennbar.
Erkannte
Dunkelheit und Unwissenheit gehört daher zur Wahrheit. Und die Wirklichkeit
kann überhaupt nicht verborgen werden.
Dunkelheit
und Unwissenheit verbergen für uns die reale Welt, die sich aber unabhängig
davon genau so manifestiert wie sie ist.
Nagarjuna
fragt uns daher. wie eine solche Wirklichkeit ein subjektives Ich erzeugen
kann. Da die Wirklichkeit immer eine Einheit von Subjektiven und Objekt-bezogenen
ist, kann es ein nur subjektives Ich
überhaupt nicht geben. Eine solche Existenz ist also absurd.
Was
sich aber vor uns manifestiert, arbeitet kraftvoll. Denn die Wirklichkeit zeigt
sich auch klar, jenseits von unserem intellektuellen Verstehen.
Nichts
kann in der Welt völlig unverändert
ein zweites Mal entstehen und geboren werden.
Vers
14
Ob
wir es merken oder nicht, wir neigen dazu zu glauben, dass die Welt etwas
anderes ist, als was sich direkt vor uns manifestiert. Aber was sich nicht
manifestiert, kann niemals ein reales Phänomen sein.
Diese
Welt manifestiert sich als etwas, das nicht mit Worten vollständig erklärt
werden kann. Wie im Kapitel über das Gehen ausgeführt, gibt es keine
Wirklichkeit in der Vergangenheit, in der gedachten
Gegenwart und in der Zukunft, sondern nur im konkreten Handeln.
Religiöse
und idealistische Philosophien bestehen darauf, dass es eine Wirklichkeit gibt,
die sich grundsätzlich vom Alltag unterscheidet. Das Gegenteil trifft bei
materialistischen Philosophien zu, die wiederum Ideen, Spiritualität und oft
auch Moral abstreiten oder für unwichtig ansehen.
Nach
Nagarjuna sind beide Ansätze falsch.
Es ist von größter Wichtigkeit. die reale Wirklichkeit anzuerkennen und klar zu
unterscheiden, ob es sich um Ideen oder Glauben handelt.
Vers
15
Häufig
besteht die Vorstellung, dass die Wirklichkeit sich uns erst zukünftig nähern
wird, aber nicht das ist, was sich direkt
vor uns offenbart und manifestiert. Das ist nach Nagarjuna unrichtig.
Es
ist daher auch nicht möglich die Wirklichkeit der Geburt klar und konkret zu
erfahren. Das Gleiche gilt für den zukünftigen Tod. Über Beides machen wir uns
lediglich gedankliche Vorstellungen, diese sind aber nicht mit der Wirklichkeit
identisch.